
Vorsicht Keimfalle? Warum die Bargeld-Warnung der Sparkassen über das Ziel hinausschießt
Die Sparkassen haben in einer aktuellen Veröffentlichung vor der angeblichen Keimbelastung von Bargeld gewarnt. Banknoten und Münzen würden als „Nährboden für Mikroben“ fungieren, hieß es – und die Empfehlung lautet sinngemäß: besser kontaktlos zahlen. Was auf den ersten Blick nach einem verantwortungsbewussten Hygienetipp klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als problematische Übertreibung mit fragwürdiger Stoßrichtung. Denn weder Virologen noch Hygiene-Experten sehen in Bargeld ein ernstzunehmendes Infektionsrisiko. Die Warnung offenbart vielmehr eine Tendenz zur systematischen Schwächung des Bargelds – ausgerechnet durch jene Institutionen, die es eigentlich bereitstellen sollten.

Die Warnung der Sparkassen stützt sich auf Studien wie das sogenannte Dirty Money Project, das vor einigen Jahren durch Medienberichte bekannt wurde. Wissenschaftler hatten dabei Tausende genetische Spuren von Mikroorganismen auf US-Dollar-Banknoten identifiziert. Neben harmlosen Hautbakterien fanden sich auch vereinzelt Mikroben, die mit Infektionen in Verbindung gebracht werden können. Die Schlussfolgerung lautete: Geld ist nicht steril – ein trivialer Befund, der auch für Türklinken, Einkaufswagen oder Bankkarten gilt.
Doch was in der medialen Darstellung oft untergeht: Das bloße Vorhandensein von Mikroben bedeutet nicht automatisch ein Infektionsrisiko. Die Studien analysierten DNA-Spuren, keine lebenden Krankheitserreger. Ob diese Spuren tatsächlich infektiös sind, wurde in der Regel nicht untersucht – und in realistischen Alltagsumgebungen ist die Übertragungswahrscheinlichkeit ohnehin äußerst gering.
Kein Infektionsherd: Was Virologen sagen
Führende Fachinstitutionen wie das Robert Koch-Institut (RKI), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Seuchenschutzbehörde CDC haben sich mehrfach mit der Frage befasst, ob Bargeld eine bedeutende Rolle bei der Übertragung von Infektionskrankheiten spielt. Das Ergebnis ist eindeutig: Eine relevante Ansteckungsgefahr durch Banknoten oder Münzen konnte bislang nicht nachgewiesen werden.
Während der COVID-19-Pandemie wurden spezielle Untersuchungen angestellt. Die Europäische Zentralbank ließ im Jahr 2021 prüfen, wie lange SARS-CoV-2 auf verschiedenen Geldarten aktiv bleibt. Ergebnis: Auf Banknoten verliert das Virus unter Alltagsbedingungen schnell seine Infektiosität – deutlich schneller als auf Kunststoffkarten oder Metalloberflächen. Auch Noroviren, Rhinoviren oder Rotaviren, die laut Sparkassenmeldung potenziell auf Bargeld überleben können, benötigen meist hohe Dosen und feuchte Umgebungen, um infektiös zu bleiben – beides ist bei typischem Bargeldumlauf kaum gegeben.
Kupfer als natürlicher Schutz
Besonders auffällig ist, dass die Sparkassen auch Münzen als Keimträger bezeichnen – obwohl gerade diese durch ihre Zusammensetzung eine keimtötende Wirkung entfalten können. Viele Euro-Münzen, insbesondere die Cent-Stücke, enthalten einen hohen Anteil an Kupfer. Dieses Metall ist bekannt für seine antimikrobiellen Eigenschaften: Es zerstört Zellwände von Bakterien, deaktiviert Viren und hemmt Pilzwachstum.
Studien des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben gezeigt, dass Kupferlegierungen innerhalb kurzer Zeit Keime abtöten können – ein Grund, warum Türklinken in Krankenhäusern zunehmend aus Kupfer gefertigt werden. Die Vorstellung, dass solche Münzen „Brutstätten für Keime“ seien, widerspricht also nicht nur dem aktuellen Forschungsstand, sondern auch dem Prinzip der Materialwahl bei der Euro-Gestaltung.
Ratgeber: Wie schütze ich mich vor Enteignung?
- → Welche konkreten Enteignungsrisiken auf Sie zukommen
- → Wie Sie Ihr Vermögen rechtssicher vor staatlichem Zugriff schützen
- → Bewährte Strategien für echten Vermögensschutz
- → Praktische Sofortmaßnahmen, die Sie heute umsetzen können
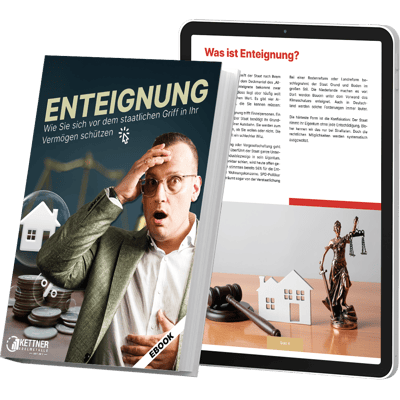
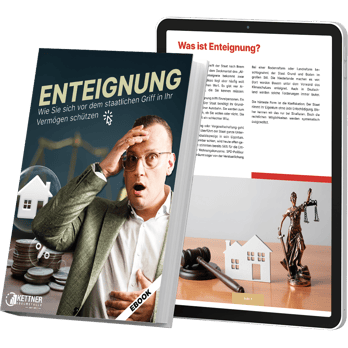
Der Vergleich mit Karten und Smartphones
Werden bei der Diskussion über Bargeldhygiene auch andere Zahlungsmittel betrachtet, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Bankkarten, Smartphones oder Kassenterminals werden täglich von Millionen Menschen berührt – häufig ohne Zwischenreinigung. Gerade Smartphones gelten inzwischen als wahre Keimbomben. Eine Studie der University of Arizona zeigte bereits 2012, dass auf Handyoberflächen bis zu zehnmal mehr Bakterien zu finden sind als auf WC-Sitzen. Dennoch warnt kaum jemand vor der Nutzung dieser Geräte.
Der Unterschied liegt offenbar nicht in der hygienischen Realität, sondern in der Wahrnehmung: Bargeld gilt als „altmodisch“, Karten und Apps als modern und sauber – obwohl objektive Hygienefaktoren diese Annahme kaum stützen. Wer auf Hygiene Wert legt, sollte nicht Bargeld meiden, sondern sich regelmäßig die Hände waschen. Das ist wesentlich effektiver – und gilt übrigens auch für Kartenzahlungen.
Ein seltsames Signal der Sparkassen
Vor diesem Hintergrund überrascht der Vorstoß der Sparkassen. Als Anbieter der Bargeldversorgung – insbesondere im ländlichen Raum – tragen sie eine besondere Verantwortung. Wenn diese Institution nun öffentlich das eigene Produkt als potenzielles Gesundheitsrisiko brandmarkt, sendet sie ein widersprüchliches Signal. Nicht nur untergräbt sie das Vertrauen in ein gesetzliches Zahlungsmittel – sie liefert auch Wasser auf die Mühlen jener, die Bargeld aus dem Alltag drängen wollen.
Dabei ist der Zugang zu Bargeld für viele Menschen weiterhin essenziell: Ältere, einkommensschwache und technikferne Bevölkerungsgruppen sind in besonderem Maße auf Bargeld angewiesen. Auch aus Gründen des Datenschutzes und der persönlichen Freiheit ist Bargeld unverzichtbar. Die WHO bezeichnet Bargeld ausdrücklich als Teil einer inklusiven Finanzinfrastruktur – ein Standpunkt, den die Sparkassen eigentlich teilen sollten.
Strategische Interessen statt Hygieneschutz?
Kritiker vermuten hinter der Bargeld-Warnung eine tiefere Strategie. Seit Jahren bauen viele Kreditinstitute ihre Bargeldinfrastruktur zurück: Filialen werden geschlossen, Geldautomaten abgebaut, Barverfügungen verteuert. Parallel dazu wird der Ausbau digitaler Bezahlplattformen vorangetrieben, bei denen Banken und Paymentdienstleister an jeder Transaktion verdienen. Die Warnung vor „Keimgeld“ passt in dieses Bild – sie stärkt indirekt die Akzeptanz kontaktloser Zahlungsmethoden.
Die Sparkassen treten damit in einen Zielkonflikt: Einerseits sollen sie die Bargeldversorgung im Sinne der Daseinsvorsorge sicherstellen, andererseits profitieren auch sie wirtschaftlich von der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs. Vor diesem Hintergrund wirkt die aktuelle Warnung nicht wie ein neutraler Hygienetipp, sondern wie ein politischer Schachzug mit wirtschaftlichem Kalkül.
Ähnliche Artikel


500-Euro-Schein abgeschafft – und was als Nächstes droht

Was der Tresor-Coup von Gelsenkirchen Goldanlegern brutal vor Augen führt

Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem Goldverbot

Bargeld stirbt aus – Sparkasse, Volksbank & Co. treiben ihre Kunden in die digitale Falle

Bargeld-Abschaffung in Indien über Nacht - so schnell kann es gehen !

Sparkassen-Raub von Gelsenkirchen – wenn das Sicherheitsversprechen endgültig kollabiert

Gold und Silber kaufen: Diese 10 Fehler kommen Einsteiger teuer zu stehen

Die besten und sichersten 10 Goldverstecke zu Hause

Silberpreis sprengt die Pläne der Bundesregierung

Bargeldgrenze für anonyme Goldkäufe: Wann wird sie vollständig abgeschafft?
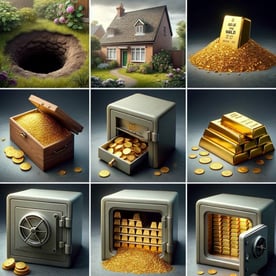
Gold verstecken - Methoden, Tipps und No-Gos

Nächster Schlag gegen das Bargeld: SPD-Politiker wollen 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen

Bargeldpflicht auf der Wiesn: Mehr als nur eine Schnapsidee

Bargeldverbot und Bargeldabschaffung – So schützen Sie sich

Der stille Rückzug großer Banknoten: Eine globale Entwicklung

Italien greift nach dem Gold seiner Bürger – und Europa sollte sich darauf gefasst machen
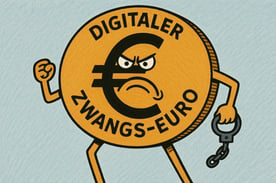
EU-Verordnung schockt Einzelhandel: Zwang zum digitalen Euro ab 2029!
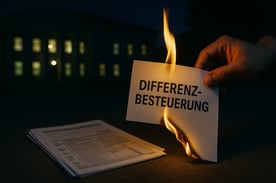
Silbersteuer-Schock: Wie die Differenzbesteuerung praktisch über Nacht abgeschafft wurde

Häme nach dem Tresor-Raub von Gelsenkirchen: Wie schnell Opfer zu Schuldigen gemacht werden

Silbermünzen immer teurer – und immer weniger gefragt

Bundesbank schließt Filialen: Ist unsere Bargeldversorgung gewährleistet?

Zwangswechselkurs für Gold: Wie Italien den Anlegern ihre Freiheit nahm



